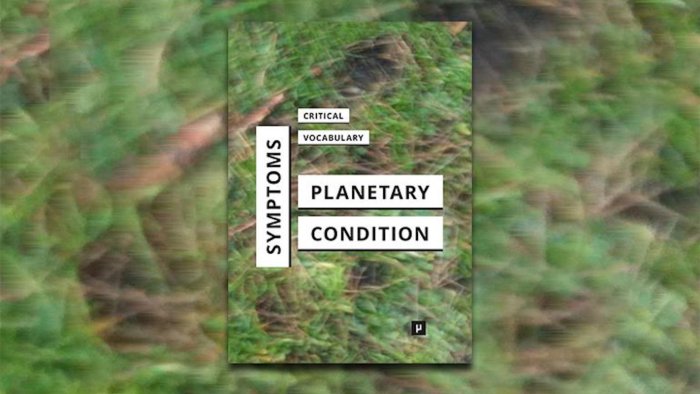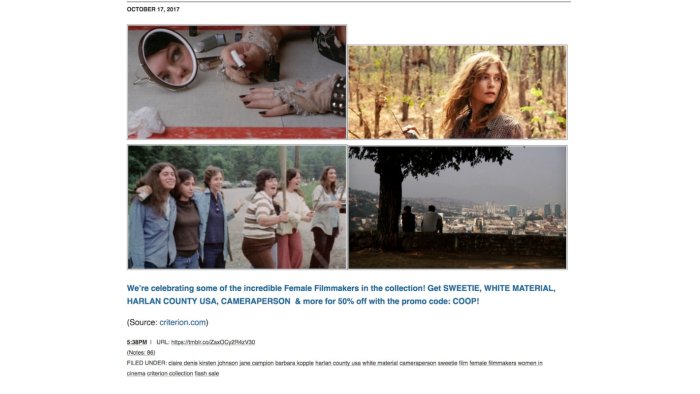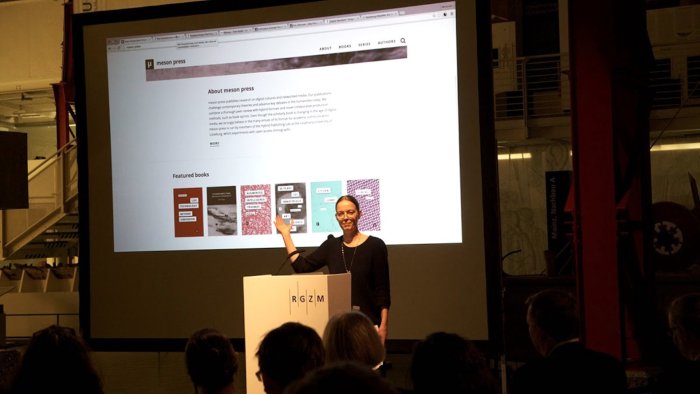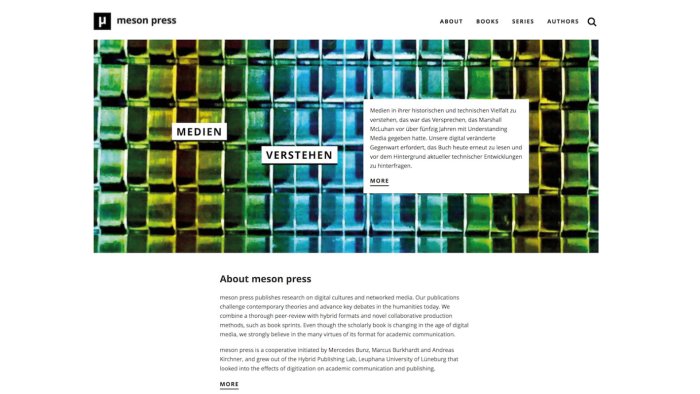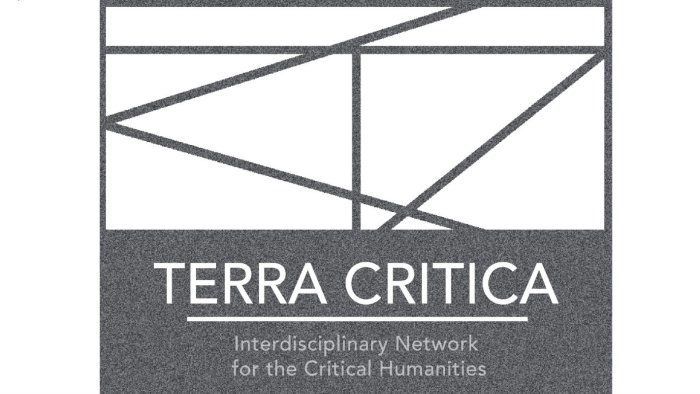Kritik neu denken | Mercedes Bunz
«Es geht heute darum, sich über die Kritik hinaus als verantwortlich und teilnehmend zu begreifen»

Kritik neu denken
Mercedes Bunz befasst sich als Kulturwissenschaftlerin und Journalistin intensiv mit der Frage, wie sich mit digitalen Technologien und neuen Medien unsere gesellschaftliche Organisation verändert. Kritik, so Bunz, kann Veränderung gestalten – indem sie über ein Urteilen hinausgeht und bewusst Öffentlichkeiten schafft. Dafür müssten sich mehr Menschen mit den komplexen Mechanismen des Internets auseinandersetzen.
Text-Interview with Mercedes Bunz
Mercedes Bunz, wie haben die digitalen Produktionsmechanismen und das Internet die Art und Weise verändert, wie über (Film-) Kunst nachgedacht und publiziert wird? Welches sind für Sie die bedeutendsten Entwicklungen diesbezüglich?
Das Internet ist einer von mehreren Faktoren, die zu Veränderungen geführt haben, die mittlerweile ja im Allgemeinen bekannt sind. Man kann leichter publizieren, es gibt also eine Öffnung. Wunderbare Fachzeitschriften gab es natürlich schon immer. Nun kann man sich aber sehr spezifischen Aspekten von Film (oder Kultur im Allgemeinen) widmen. Kritik oder Kultur findet zudem auch nicht immer mehr nur im Wort statt, sondern kann auch als Präsentation von Material auf einem Tumblr passieren, wie bei criterioncollection.tumblr.com.
Zum anderen werden die digitalen Möglichkeiten genutzt, indem Künstler und Filmemacher ihre Videos direkt ins Netz stellen. Das Interessante am Film ist ja: Film und Internet gehen an bestimmten Stellen nahtlos ineinander über – und das ist für mich eine weitaus bedeutendere Entwicklung. Film ist durch das Internet viel zugreifbarer geworden. Es fungiert als Filmarchiv. Darüber hinaus gibt es Programmierer wie Robert Ochshorn, die mit der Möglichkeit, Filme zu „lesen“, spielen: z.B. auf montageinterdit.net oder rmozone.com.
Die Instrumente der Kritik, wie sie seit der Aufklärung eingesetzt wurden, hätten ausgedient, schreiben Sie zusammen mit Birgit Mara Kaiser und Kathrin Thiele in Symptoms of the Planetary Condition: A Critical Vocabulary. Weshalb?
Grundsätzlich muss man den Begriff der Kritik als Analyse vom Begriff der Kritik als Beurteilung unterscheiden. Bei Terra Critica, dem philosophischen Netzwerk, dem ich angehöre und welches für den wichtigen Hintergrund des besagten Buches verantwortlich zeichnet, bei Terra Critica geht es darum, sich von Letzterem wegzubewegen, also von der Kritik als Urteil.
Welches sind deren Wesenszüge?
Die klassische Form von Kritik ist durch die typisch binäre westliche Weltsicht kodiert. Ich, Subjekt, beobachte Objekt. Die Trennung des Subjekts vom Objekt wurde dabei durch Negativität hergestellt. Die Autonomie des Subjekts vom Objekt zeigt sich deshalb auch klar, wenn das Subjekt das Objekt unvoreingenommen beschreibt. Dazu muss es Unvoreingenommenheit demonstrieren, für die es negative Kritik braucht. Mit positiver Kritik funktioniert die Herstellung von Autonomie selten gut. Die Negativität ist also ein Trick, welche Subjekt und Objekt spaltet und herstellt.
Und diese Spaltung soll überwunden werden?
Es geht heute darum, sich über die Kritik hinaus als verantwortlich und teilnehmend zu begreifen. Klimawandel können wir alle ungut finden. Das reicht aber nicht. Sich als teilnehmend und verantwortlich zu begreifen, ist natürlich weitaus schwieriger. Man muss sich in seinem Gebiet eine Position suchen, die mit an der Sache arbeitet. Das Buch Symptoms of our Planetary Condition, aber auch die Gruppe Terra Critica, testet aus, wie das im Bereich der Theorie gehen könnte. Also nicht nur zu sagen: der Kritik-Begriff, der nur urteilt, hat ausgedient. Sondern zu fragen: Wie kann man Kritik theoretisch umdenken und weiterdenken? Denn Kritik ist natürlich in dem kapitalistischen System, in dem wir leben, lieben und arbeiten, tief verankert. Dieser Verantwortung von Verankerung muss man sich stellen. Stay with the trouble, wie Donna Haraway sagt.
Wie also kann man Kritik weiterdenken?
Es geht um ein Denken von Theorie – also um den Ausbau von theoretischen Konzeptionen von Kritik – die man zugleich als ein Teil von Welt sieht. Das stellt Anforderungen an die eigene Alltagspraxis. Der moralische Grundsatz dafür lautet: Wie kann man alle Orte, an denen man sich gerade aufhält, ein wenig besser verlassen als man sie vorgefunden hat? Und das betrifft, wie man untereinander kommuniziert, welchen Dreck man beseitigt (nicht nur den eigenen) und wie man die Welt für andere zu einem angenehmeren Ort machen kann (das geht vom Anbieten eines Tees und einem freundlichen Wort hin zum gemeinnützigen oder politischen Engagement).
Das sollte ja gar nicht so schwer sein...
Die theoretisch praktische Herausforderung besteht darin, keine Seite besser zu finden. Anstelle dessen gilt es, die Komplexität von Situationen anzunehmen und auszuhalten, dabei aber seinen eigenen Standpunkt nicht aufzugeben. Wir erleben gerade wieder heftige grund-dialektische Spaltungen überall auf der Welt, sozusagen die Rückkehr des Kalten Krieges im Plural: Trump, Brexit, Katalonien oder die Diskussion um die Berliner Volksbühne Anstelle dessen, die andere Seite als unannehmbar darzustellen, gilt es hier vielmehr, den eigenen Standpunkt nicht gegen die andere Seite zu formulieren, sondern für etwas – für einen Wert in der demokratischen Politik, für europäische Politik, für das Theater.
(Wie) Kann man dies auf den Bereich der Kulturpublizistik oder eben der Filmkritik übertragen?
Die Schwierigkeit haben Sie natürlich gut erkannt. Im Begriff des Kritikers ist das Negativ-Finden und die distanzierte Haltung gewissermassen enthalten, denken wir. Das ist aber nicht unbedingt die Hauptsache. Ich beschreibe mal zwei alternative Momente: Im Augenblick unterrichte ich das Schreiben von Kulturkritiken. Die Schwierigkeit, eine gute Kritik zu schreiben liegt selten an der Meinung, positiv oder negativ. Die ist meist vorhanden. Das Problem ist vielmehr eine informierte oder vielleicht sogar eine gut informierte Meinung zu haben. Dazu braucht es Fachkenntnis und Überblick. Wenn Sie eine Filmkritik oder sogar eine Restaurantkritik analytisch auseinandernehmen, können Sie relativ weit vorne oft einen Verweis auf den Kontext des zu besprechenden Objektes finden: Genre, aktuelle oder vergangene Geschichte des Formates, Problemstellungen. Und an genau diesen Punkt muss man als Kritiker heute meines Erachtens einsetzen.
Inwiefern?
Indem man weniger die enge Werkfrage stellt – ist das Stück, der Film, das Menü gut oder schlecht? – sondern den Fokus auf die Frage danach legt: Wie passt das, was man sieht, in die heutige Zeit, wie setzt es sich damit auseinander? Diese Perspektive lässt einen anderes sehen und auch anders schreiben. Die Aufgabe, das Werk einzuordnen, hatte der Kritiker natürlich schon immer. Man muss das Kritiker-Dasein und das Format Kritik also nicht neu erfinden, sondern einfach eine Seite der Kritik etwas mehr betonen.
Und das zweite alternative Moment?
Das Auswählen: ein wichtiger Vorgang. Man muss den Akt, worüber man schreibt und worüber man nicht schreibt, immer als eine Entscheidung für etwas begreifen. Als ich noch bei der De:Bug – Zeitschrift für Elektronische Lebensaspekte war, diskutierten wir oft, warum wir so viele positive Plattenkritiken hatten, dank des fleissigen Sascha Kösch. Wir hätten auch schlechte Platten besprechen können, damit die Auswahl ausgewogener wäre – die elektronische Musik explodierte ja damals in den Neunzigern. Wir sahen unsere Auswahl aber als mikropolitische Geste: Anstelle dessen, das Schlechte in der Welt zu betonen, wollten wir das Positive sichtbarer machen. Macht Sinn, oder?
Blickt man auf den Filmbereich, wird beklagt, dass sich Auswahl und Präsentation heutzutage hauptsächlich am Unterhaltungswert orientieren. Video-Essays, die vor ein paar Jahren noch als vielversprechende neue Reflexionspraxis gefeiert wurden, seien zu einem Teil des «21 century entertainment complex» geworden, sagt ein früher Protagonist des Genres, Kevin B. Lee. «Very few have a challenging position towards film & media». Woran liegt dies?
Wenn „challenging“ meint „verneinend“, dann denke ich, dass dies mit der oben beschriebenen Verschiebung zu tun hat. Diese schwierige Welt zu kritisieren bedeutet eben nicht nur, sie als fehlerhaft zu befinden. Ich nehme an, dass der Film-Essay jetzt eben auch unterhaltend geworden ist. Das heisst aber nicht, dass er nicht immer noch „challenging“ sein kann. In meiner Welt sehe ich durchaus Filmarbeiten, die Film als Material analytisch diskutieren, allerdings eher analytisch und nicht negativ-kritisch. Steve hates Fish von John Smith zum Beispiel experimentiert mit manipulierten Bildern. Das stellt für mich drastisch unser Vertrauen in filmische Realität in Frage, ohne jedoch zu sagen: Das ist falsch. Es sagt eher: Das ist da und so funktioniert es. Wichtig zu wissen. Das ist vielleicht der andere Gestus.
Wie würden Sie ein fruchtbares Verhältnis zwischen Künstler und Kritiker beschreiben?
Die Trennung Künstler/Kritiker funktioniert im Zeitalter der Informationsvorhandenheit nicht mehr so reibungslos. Klassisch sagten wir: Du, Künstler, bist im Werk und studierst für das Werk. Ich, Kritiker, bin im Genre und studiere, um dort Experte zu sein. Das ist heute anders. Alle hervorragenden Künstler kennen sich heute extrem gut in ihrem Genre aus. Künstler und Kritiker arbeiten also ein ähnlicheres Wissen anders durch, denn Ihre Darstellungsweisen haben verschiedene Funktionen.
Welche Rolle kommt der Vermittlung zu?
Analyse und Übersetzung sind heute zentrale Funktionen von Kritik. Denn Vermittlung braucht es im Zeitalter von Informationsvorhandenheit auf jeden Fall. Die Rolle des Kritikers hat sich aber geändert. Der gestiegene Anspruch an den Kritiker ist jetzt, sein Expertenwissen auch mehrdimensional kommunizieren zu können, also auch ein interessiertes Publikum zu informieren und Nicht-Experten mitzunehmen. Er liefert den Überblick. Wohin soll ich bitte gucken?
Ist es im Netz möglich, Relevanz jenseits von Klickraten herzustellen?
Ja natürlich. Relevanz hat begrifflich ja nicht nur Bedeutsamkeit, wenn etwas viele gut finden. Die Frage macht den Begriff aber leider leicht platt. Der Relevanzbegriff in der Kultur wendet sich nicht an viele. Eigentlich schade, dass wir in unserer Kultur nicht mehr fähig sind, Relevanz ausserhalb von Masse zu verankern. Denn das ist ja das Tolle: Was relevant ist, ist perspektivbedingt. Feinmaschig arbeitende Fachblogs stellen sich die Frage nach den Klickzahlen nicht. Da geht es um das richtige Publikum und nicht um ein großes Publikum. Hohe Zuschaueraufmerksamkeit ist nur für Massenthemen und Massenplattformen relevant. Eigentlich traurig, dass wir das Internet immer nur auf ein Massenphänomen reduzieren und damit runtermachen. Als kulturtechnisches Tool wird es viel zu wenig ernst genommen. Die vielen Tausenden von Webseiten oder Twitter-Nutzern, die Relevanz anders begreifen, und gepflegt pointierte Sachen veröffentlichen, die fallen einfach unten durch.
Die Planetary Condition ist aber letztlich doch ein Massenthema. Wäre es dann nicht Ziel jeden Nachdenkens darüber, möglichst viele Personen damit zu erreichen?
Massen habe die Eigenschaft, einen kleinsten gemeinsamen Nenner zu haben. Das ist nicht immer wirksam. Wenn man nur einen kleinen gemeinsamen Nenner hat, sind der Zusammenhalt und die Anbindung an dringliche Anliegen eher schwach. Man bringt Leute mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner schlecht zum Nachdenken – der passt einfach nicht auf alle. Nachdenken findet meist bei Begegnungen mit dem Unangenehmen oder dem Gelungenen statt.
Welche Eigenschaften haben denn smarte Inhalte, die zu unerwarteten Begegnungen führen?
Ich glaube nicht, dass ein smarter Inhalt per se eine agency hat, die dazu führt, dass wir uns über unseren eigenen Tellerrand beugen. Als Mensch sind wir ja ebenso skeptisch wie neugierig. Die Hoffnung liegt dann gerne in der Multitude: Man kann genauso viele Personen erreichen, indem man verschiedene Ansätze zu ein und demselben Thema zulässt. Wenn die unkoordiniert bleiben, kann das jedoch zur Multitude-Bubble führen – auf der linken Seite haben wir damit ja in der Geschichte eindringliche Erfahrungen gemacht und wirksame Revolutionen in den Sand gesetzt.
Das Herstellen von Relevanz ist also eine Kunst. Wir wissen, wie es geht, aber die praktische Umsetzung gestaltet sich als schwierig (leider und zum Glück, im Moment wird Relevanz ja oft auf der falschen Seite hergestellt, siehe den deutschen Nationalrutsch oder den britischen Brexit). Wir wissen aber: Man braucht eine Kerngruppe, welche ein Anliegen teilt. Und um die zu erreichen, muss man den dafür richtigen Tonfall, Kanal und das richtige Medienformat finden, indem sich die Kommunikation wohl fühlt. Sorgfältige Kommunikation sozusagen.
Ist ein netz-basierter Diskurs überhaupt möglich?
Sie fragen das jetzt, weil der Tonfall von Kommentaren im Netz unmöglich ist? Das ist in der Tat der Fall. Das bedeutet aber nicht, dass im Netz nicht diskutiert werden kann. Es ist leider aber so, dass ab einer bestimmten Anziehungskraft von Menschenansammlungen (was wir früher Masse nannten) der kleinste gemeinsame Nenner sehr klein geworden ist. Und dass wir da viel zu lange zugeguckt haben und das zugelassen haben, dass dieser Tonfall „okay“ geworden ist. Scheusslich. Man sollte aber nicht unfair sein und die Klowand einer Universität mit dem Vorlesungsraum verwechseln. Was gilt hier als Netzdiskurs und warum? Wo gucken wir hin?
Haben Sie ein Beispiel?
Dass schwierige Themen durchaus im Netz diskutiert werden können, wenn man sich an die richtige Öffentlichkeit wendet, zeigt etwa die Merkur-Blog-Veröffentlichung über Sexismus an Schreibschulen. Wie kann man sich an die richtige Öffentlichkeit wenden? Mit gekonntem Umgang im Tonfall, und kultivierter Kommunikation. Öffentlichkeiten sind nicht einfach da, die stellt man her. Das macht Arbeit – zum Beispiel die Arbeit, Teilnehmer anzuschreiben und einzuladen. Sich die richtige Plattform für die Veröffentlichung zu suchen. Oder den richtigen Medienpartner.
Was mir an Ihrer Frage aber ein wenig unheimlich ist, ist die Trennung von Medium und Diskurs, die darin signalisiert wird, dass nach der Möglichkeit von netzbasiertem Diskurs gefragt wird, als ob Diskurs erstmal überhaupt möglich ist bzw. Diskurs ohne Netz, aber auch nicht mit einem anderen Medium. Eine Trennung Medium/Diskurs ist für mich nicht gegeben, da hat sich Foucault doch gut in das Gehirn eingeschlichen. Das Medium Internet ist Teil unseres zeitgenössischen Diskurses auch jenseits von Facebook. Diskurse finden nicht nur in Texten statt. Vielleicht muss man seinen Blick einfach ein wenig umstellen und den Diskurs mal offen woanders suchen, als dort, wo man ihn vermutet. Also nicht an diesen Schrei-Plätzen. Dazu muss man sich dem Netz aber etwas gründlicher widmen.
Wo existieren oder entstehen öffentliche Räume, auf deren Basis gesellschaftliche Verständigung möglich ist?
Eine gesamtgesellschaftliche Verständigung ist nicht möglich. War sie auch noch nie. In meinen Augen ist das auch eine gruselige Vorstellung. Die Dissonanz und das Missverständnis sind Grundbestandteile westlicher Gesellschaften. Sie machen uns alle vorsichtig. Das ist gut.
Das Kuratieren von Inhalten spielt angesichts des Informationsüberschusses im Internet eine zentrale Rolle. Inwiefern hat sich diese Funktion gegenüber derjenigen von traditionellen „Gatekeepern“ wie Feuilletonredaktoren verändert?
Wir wissen ja alle, dass man an die Inhalte einfacher herankommt als früher und sie auch einfacher herausgibt. Man muss nicht unbedingt einen Redaktionsapparat dafür haben. Allerdings muss irgendwann jemand das Kuratieren auch bezahlen, wegen der Miete, die am Monatsende zu begleichen ist. Und auf der Ebene wird dann der „Gatekeeper“ bzw. werden die Hierarchien doch wieder eingeführt. Inhalte machen nämlich Arbeit, ganz egal, ob ihre Verarbeitung einfacher oder aufwendiger ist.
(Wie) Können Menschen angesichts der Bedeutung von Algorithmen überhaupt gestaltend in den Aggregations-Prozess von Inhalten eingreifen?
Mich macht die Hilflosigkeit von Menschen angesichts von Algorithmen hilflos und ich kann deshalb nur ehrlich antworten: Fundamentale Begriffe wie „Mensch“ oder „Algorithmen“ bzw. „Mensch angesichts von Algorithmen“ finde ich schwierig. So eine Brutalkategorisierung macht mir Bauchschmerzen. Was sind das für Menschen? Können sie programmieren und sind hilflos? Oder wollen sie sich nicht mit Programmieren beschäftigen und dass sie es müssen, das macht sie hilflos? Sind Algorithmen nicht menschliche Produkte? Warum sind Menschen ihnen gegenüber dann hilflos? Zumindest da gibt es Licht am Horizont: Die Bedeutung und Regulierung von Algorithmen, wie sie die Wirtschaft einsetzt und wie sie von Konsumenten massenhaft angenommen werden, ist auf der Ebenen der EU ein deutliches Thema. Die EU hat mit der Datenschutz-Grundverordnung ein sehr wichtiges Gesetz verabschiedet, das im Mai 2018 aktiv wird und sich wenig hilflos zeigt. Mit Kenntnis hat man ein Gesetz verabschiedet, das Algorithmen im Sinne von Bürgern und nicht im Sinne von Firmenbesitzern reguliert. Das ist doch mal eine gute Sache. Danke dafür an die EU-Menschen.
Sorgt das Internet in Ihren Augen für eine Demokratisierung von Kulturproduktion und -rezeption?
Das Internet kann für keine Demokratisierung sorgen. Das machen nur Menschen, die es so oder anders nutzen. Technologien haben bestimmte Tendenzen. Die Umsetzung dieser Tendenzen geschehen jedoch nicht vollautomatisch und von alleine. Wenn sich mehr Leute anstrengen würden, in das Internet hinein zu investieren und seine ebenso schwierigen wie interessanten Mechanismen zu nutzen, dann sähe die Sache noch besser aus. Leider gilt es ja als schick, sich kritisch-herablassend in Bezug auf das Internet zu äußern und es gleichzeitig fleissig zu nutzen. Typisch westliche Doppelmoral. Schade eigentlich.
*
Das Interview wurde schriftlich von Jacqueline Beck geführt - September 2017
Mercedes Bunz unterrichtet an der University of Westminster in den Lehrgängen New Media Journalism und Social Media Culture and Society. Sie ist Mitglied des internationalen Forschungsnetzwerks Terra Critica und Mitbegründerin des Open Access-Verlags meson press. Bunz hat die Bücher The Internet of Things, Symptoms of the Planetary Condition: A Critical Vocabulary und The Silent Revolution: How Digitalization Transforms Knowledge, Work, Journalism and Politics without Making Too Much Noise veröffentlicht. Als Journalistin war sie in leitender Funktion bei De:Bug, Zitty, Tagesspiegel und dem The Guardian tätig.
Images © Thomas Lohr, Mercedes Bunz